Weihnachten mit Frieda Zuckerman
Ich bin in New York City geboren. Wenn ich direkt mit Ihnen plaudern könnte, würden Sie das an meinem Akzent auch merken.
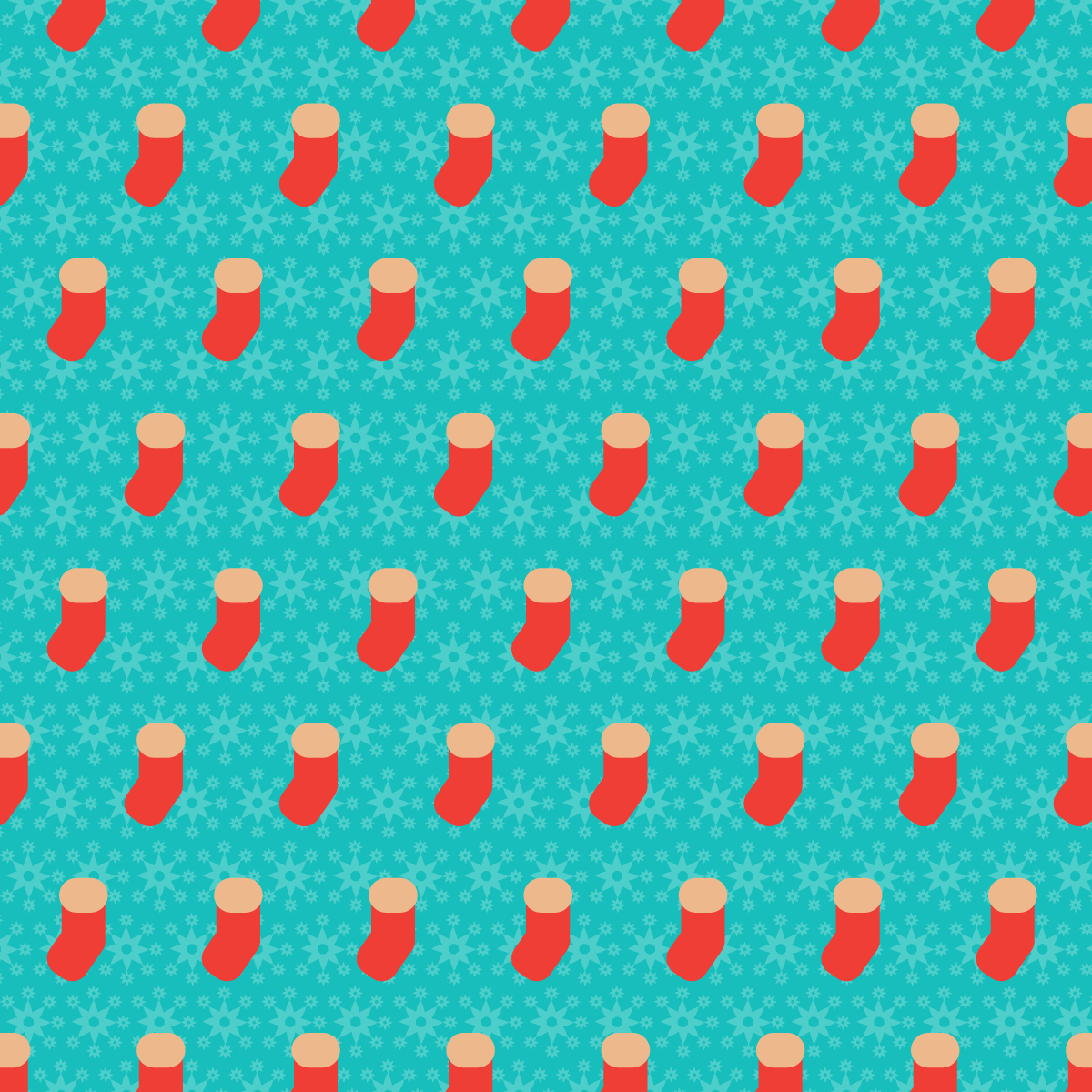
Ich bin in New York City geboren. Wenn ich direkt mit Ihnen plaudern könnte, würden Sie das an meinem Akzent auch merken. Aber da Sie hier nur Buchstaben vor sich haben, werden Sie sich wohl einfach auf mein Wort verlassen müssen. Wie alt ich bin, verrate ich nicht – so viel erzähle ich Ihnen aber doch: Aufgewachsen bin ich in der Großen Depression.
Es kam uns gar nicht in den Sinn, dass „Santa Claus nur für die Christen war“.
Unsere Nachbarn waren größtenteils konservative oder orthodoxe Juden. Ein paar eingewanderte Nichtjuden waren auch unter uns verstreut, die aus ihrer Abneigung gegen uns ganz und gar keinen Hehl machten. Daher klingt es vielleicht überraschend, dass in meiner Gegend sogar jüdische Kinder an Weihnachten ihre Strümpfe an den Kamin hängten und hofften, Santa Claus werde sie mit Geschenken füllen. Es kam uns gar nicht in den Sinn, dass „Santa Claus nur für die Christen war“. Wenn wir in Bezug auf Santa Claus überhaupt etwas glaubten, dann, dass er für Kinder war!
Ein einziges Mal hängte auch ich meinen Strumpf auf. Das nahm meine Mutter zum Anlass, einige Realitäten des Lebens zu erklären. In höchst unmissverständlichen Worten teilte sie mir mit, dass Santa Claus nur in ihrem Geldbeutel existiere – einem Geldbeutel, der an vielen Tagen im Jahr leer bleibe, und Weihnachten sei da keine Ausnahme. Santa Claus sei ein Mythos, sagte sie, und „a jiddisches Meydele“ wie ich, solle wahrhaftig nicht daran glauben. Ich entdeckte, dass meine Strümpfe nur einen sehr begrenzten Verwendungszweck hatten – sie gehörten nämlich einfach zwischen meine Füße und meine Schuhe! Immerhin erklärte Mutter, dass wir auf so manch andere Weise Geschenke bekämen; und für solche Geschenke sollten wir Gott danken.
„A jiddisches Meydele“ wie ich, solle wahrhaftig nicht an Santa Claus glauben.
Mutter war eine fromme Frau; Vater war Kantor und ebenfalls religiös. Für den Alltagsgebrauch hatten wir zwei getrennte Garnituren Geschirr, Silberbesteck, Kochgeräte und so weiter; an Passah verwendeten wir nochmal ein Extra-Service mit allem drum und dran. Ich besuchte mehrere Jahre lang die Talmud-Tora-Schule und erhielt, kurz gesagt, eine anständige jüdische Erziehung.
Dann starb mein Vater, und Mutter musste arbeiten gehen. Tatsächlich musste sie nicht nur unter der Woche, sondern auch am Schabbat arbeiten, damit weiterhin Brot auf den Tisch kam. Das beunruhigte sie zunächst; doch dann argumentierte sie, es sei ja schließlich eine Notwendigkeit, und darum werde Gott ihr bestimmt verzeihen. Diese Argumentation wurde später auf nicht-koschere Schulmahlzeiten erweitert, die es zu essen galt. Trotzdem hielten wir auch weiterhin die heiligen Feiertage ein, so gut wir es eben konnten.
Als Hitler und seine wahnsinnigen Handlanger versuchten, alles Jüdische zu vernichten, begann ich Dinge zu hinterfragen, die ich stets für selbstverständlich gehalten hatte. Was war denn so anders an uns, dass wir den Zorn der Menschen auf uns ziehen sollten? Und warum hatten wir religiöse Vorschriften, die so schwer einzuhalten waren? Wie in den meisten jüdischen Häusern hatten auch wir eine Mesusa am Türpfosten daheim. Ich stellte mich davor hin und forderte Gott auf, wenn es ihn wirklich gebe, so möge er mir doch diese Dinge erklären.
Zur rechten Zeit wurden meine Gebete beantwortet. Ich besuchte eine Bibelgruppe, weil eine jüdische Klassenkameradin mich eingeladen hatte. Stella trug einen Anhänger, den ich, gelinde gesagt, schockierend fand… und provokativ. Es war ein Kreuz. Ich wollte wissen, warum ein jüdisches Mädchen sich denn so etwas umhängte. Sie erzählte mir, sie sei jüdisch und glaube an Jesus; und sie lud mich in eine Bibelstudiengruppe ein.
Dort las man gerade im Johannesevangelium. Ich weiß es noch heute: Sie lasen aus dem dritten Kapitel vor, und ich hörte, wie der Name „Mose“ genannt wurde. Das war verwirrend. Was hatte denn ein jüdischer Name (und noch dazu der Name unseres wichtigsten Propheten) in einem heidnischen Buch zu suchen? Man erklärte mir, dass die Schreiber vom Neuen Testament allesamt Juden gewesen seien – mit Ausnahme eines gewissen Dr. Lukas. Außerdem handle die dort berichtete Geschichte von dem, über den Mose und die Propheten geschrieben hätten.
Der Schwerpunkt verlagerte sich auf das, was ich immer für die „jüdische Bibel“ gehalten hatte: Wir schlugen das 3. Buch Mose auf und betrachteten den mosaischen Kalender in Kapitel 23. Ich erzählte der Bibelgruppen-Lehrerin, dass wir bei mir zuhause diese heiligen Tage einhielten – wenn auch nicht auf die Art und Weise, wie das angesprochene Kapitel sie umschrieb. Freundlich und sanft wies sie mich darauf hin, dass diese Maßstäbe von Gott eingesetzt worden waren und Menschen nicht das Recht hatten, sie zu verändern oder anzupassen. Die Lehrerin glaubte, dass unsere Feste über sich hinausgingen und auf den Einen hinwiesen, der schon bei Seiner Ankunft vollkommen dazu ausgerüstet war, die Forderungen Gottes zu erfüllen. Sie sagte, Gott habe ganz offensichtlich schon bei Einsetzung all jener Riten und Vorschriften gewusst, dass unser verstreutes Volk eines Tages ohne Tempel dastehen würde, ohne Hohenpriester und ohne Tieropfer.
Ich studierte weiter in der Bibel und erkannte nach und nach, dass ein vor dem Versöhnungstag geschlachtetes Huhn nicht das von Gott verordnete Opfer ist.
Nach 3. Mose wandte sich die Diskussion dem 53. Kapitel im Propheten Jesaja zu. Diese Christen glaubten, dass der dem jüdischen Volk verheißene Messias unser Kippur sein würde – unsere Sühne; denn Er würde die Strafe für unsere Sünden auf sich laden.
Ich studierte weiter in der Bibel und erkannte nach und nach, dass ein vor dem Versöhnungstag geschlachtetes Huhn nicht das von Gott verordnete Opfer ist. Es schien, als habe sich das von Jesus dargebrachte Opfer durch die Tatsache Seiner Auferstehung als vor Gott annehmbar erwiesen. Diese Wahrheiten wurden mir erst allmählich klar. Ich kann nicht die Minute oder den Tag beziffern, an dem Jesus zur Mitte meines Lebens wurde. Zuerst glaubte ich, dass Jesus der verheißene Messias Israels ist; dann erkannte ich über eine Reihe von Monaten hinweg, was das für mich ganz persönlich bedeutet.
Ich hatte ein neues Leben und verstand ganz neu, wer Gott ist und was Er von mir erwartet. Meine Verwirrung hinsichtlich der Verfolgung und meine Sorge hinsichtlich der Forderungen Gottes wurden ersetzt durch die Erkenntnis: Gott hat unser Volk erwählt, den Messias in die Welt zu bringen – und in Ihm sind die gerechten Maßstäbe Gottes erfüllt.
Trotzdem war es schwierig, mit meiner Mutter über meine Entscheidung zu sprechen. Sie hatte schon so viel Schmerz durchgemacht: Nicht nur ihren Mann hatte sie verloren, sondern auch meine beiden Brüder und meine Schwester waren gestorben. Ich war als ihr einziger Trost zurückgeblieben.
Weihnachten kam; und da fielen mir wieder die Worte meiner Mutter von damals ein, als ich Jahre zuvor meinen Strumpf aufgehängt hatte. Wir bekommen Geschenke auf so manche Weise; und für ein jedes dieser Geschenke sollten wir Gott danken. Weihnachten war ja schließlich trotz allem eine Zeit der Geschenke. Oh, nicht von der Sorte, wie man sie im Kaufhaus findet – vielmehr von jener Art, die meine Mutter gemeint hatte: Geschenke, die nicht unbedingt materieller Natur sind. Ich versuchte meiner Mutter zu erklären, worum es bei Weihnachten in Wirklichkeit geht, warum ich für das Geschenk des Messias so überaus dankbar war und welchen Frieden Er mir gebracht hatte. Damals machte ihr das nur Kummer. In ihren Augen war das einzige ihr verbliebene Kind eine Abtrünnige geworden. Und das tat weh. Aber Jahre später erkannte auch sie in Jesus ihren Messias.
Geschenke, die nicht unbedingt materieller Natur sind
Viele Jahre sind inzwischen vergangen. Ich wurde Krankenschwester. Ich heiratete. Mein Mann, ebenfalls Jude und an Jesus gläubig, hieß Zuckerman – so brauchte ich nicht einmal meinen Namen zu ändern! Er war ein lieber Mensch und wir verbrachten wunderbare Zeiten miteinander; aber er verstarb an Krebs. Heute bin ich viel als Freiwillige in sozialen Diensten tätig, um anderen zu helfen, soweit es mir möglich ist. Ich messe Blutdruck, arbeite als Aushilfe im örtlichen Gebrauchtwarenladen und ähnliches. Eines macht mir besonders viel Freude: An Weihnachten verteile ich immer ein Flugblatt an Leute, die ich kennenlerne und die nur ungern einsehen wollen, dass Jesus auch für jüdische Menschen ist. (Dieses Flugblatt trägt den Titel „Weihnachten ist ein jüdisches Fest … oder sollte es wenigstens sein“.) Santa Claus mag ja nur im Geldbeutel meiner Mutter existiert haben. Aber im Gegensatz zu Santa Claus ist Jesus eine Realität in meinem Leben.